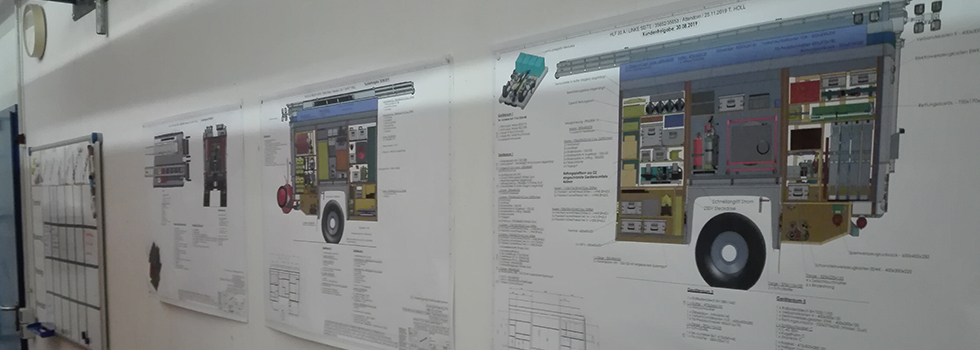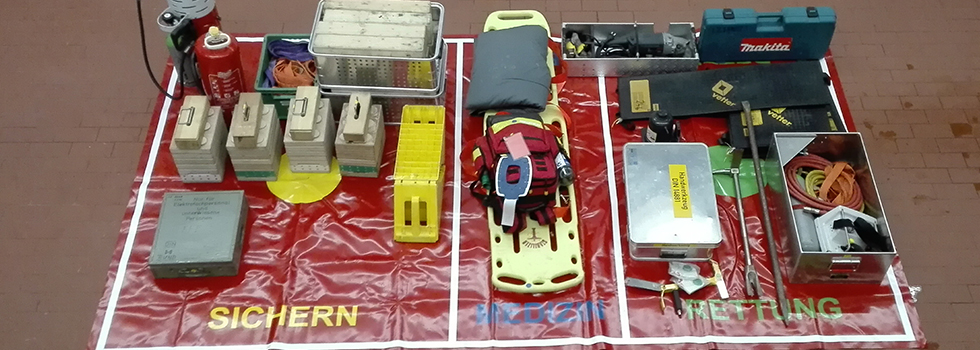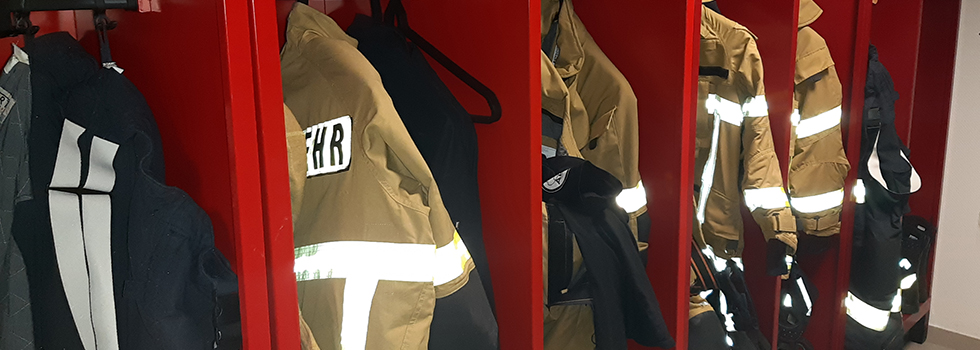„Und so riecht das Lösungsmittel Chloroform“, sagt Dr. Lars Birlenbach während ein Teilnehmer nach dem anderen an dem herumgegebenen Gläschen riecht. Zusammen mit dem Fachberater Chemie des Kreises Olpe, Jörg Koschig, dozierte der Wissenschaftler der Universität Siegen beim Symposium „ABC-Gefahren“ über das Thema Lacke und Lösungsmittel. Dabei stand stets die Praxis im Vordergrund: Verdampfbarkeit, Entzündlichkeit und Geruch vieler verschiedener Lösungsmittel – einer besonders wichtigen Substanzklasse, die im Kilotonnenmaßstab über deutsche Straßen und Schienen transportiert werden.

Foto: Sebastian Lünenstraß
Ebenfalls großtechnisch werden die Ausgangssubstanzen für die Kunststoffindustrie transportiert: Dazu gehören nicht nur die ungefährlichen Polyole, sondern auch Substanzen wie Isocyanate, Styrol oder Epoxide wie das Epichlorhydrin. Die Chemiker David Stephan und Dr. Rolf-Heiner Spies erklärten die Eigenschaften der Monomere sowie die Reaktionen mit denen sie zum Kunststoff werden. Im Labor konnten die Teilnehmer dann die mitunter heftigen Reaktionen von Styrol oder Polyolen mit Isocyanaten überzeugen.
„Der experimentelle Eindruck ist besonders wichtig“, so der Fachberater Chemie und Mitorganisator des Symposiums Klaus Ehrmann, „da Chemie im Volksglauben häufig mit ausschließlich explosionsartigen Reaktionen verbunden wird. Diese Einstellung herrscht leider auch bei vielen Einsatzkräften, sodass es im ABC-Einsatz zu regelrechten Angstzuständen vor dem was passieren mag kommen kann.“ Der Zweck des Symposiums ist daher eine differenzierte Einstellung zur Chemie zu schaffen: „Es gibt schon heftige Reaktionen in der Chemie“, erklärt Jörg Koschig, der ebenfalls als Fachberater und Organisator für das Symposium spricht, „dafür müssen aber schon bestimmte Chemikalien ineinander laufen. Und weil sie heftig miteinander reagieren dürfen sie auch weder in größeren Mengen gemeinsam gelagert noch gemeinsam transportiert werden. Somit sind heftige chemische Reaktionen im ABC-Einsatz zunächst mal die Ausnahme.“ Wie solche heftigen Reaktionen aussehen, da gab es genügend Beispiele beim Symposium zu sehen. Denn in den Räumen der Universität Siegen sind solche spektakulären Reaktionen gefahrlos möglich: „Ohne die gute Zusammenarbeit mit der Universität Siegen wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich – die notwendige Infrastruktur, Chemikalien und nicht zuletzt das gebündelte Fachwissen ist hier konzentriert. Und mit dem Vorschlag einer solchen Veranstaltung sind wir bei der Leitung der Universität auch direkt auch offene Ohren und Türen gestoßen“, beschreibt der Wissenschaftler, Koorganisator und Feuerwehrmann Stephan Vogt die Zusammenarbeit. Das gemeinsame Ziel, die Feuerwehr professionell in Chemie, Biologie und Physik zu schulen, wird auch dadurch deutlich, dass Studenten der Universität Siegen unter den Dozierenden sind. So wie Maximilian Heide, der in einem gemeinsam mit Klaus Ehrmann vorbereiteten Experimentalvortrag Reagenzien vorstellte wie sie typischerweise in der metallverarbeitenden Industrie anzutreffen sind.

Foto: Sebastian Lünenstraß

Foto: Sebastian Lünenstraß
So konnten die Kameraden hautnah verfolgen wie Schwefelsäure mit Zucker (als exemplarischer Vertreter organischer Substanzen) oder wie Salpetersäure mit Kupfer reagiert. Wichtig zu wissen, wenn man beim Brand einer Galvanik Risiken für die eigenen Einsatzkräfte abschätzen muss. Neben der feuerwehrtechnischen Relevanz stand aber auch die Eignung für alle Dienstgrade sowie die Allgemeinverständlichkeit im Vordergrund. Denn das Symposium „ABC-Gefahren“ ist eine Veranstaltung, die Feuerwehrangehörige ohne Vorkenntnis auf ein gutes fachliches Niveau in den wichtigsten Themen bringen soll.
Ergänzt wurden die Ausarbeitungen durch den ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Siegen-Wittgenstein, Dr. Jörn Worbes, der thematisierte welche Wirkung Säuren und Laugen auf den menschlichen Körper haben und anschließend Erste Hilfe Möglichkeiten erörterte. Der Fachmann für Chemikalienrecht des Regierungsbezirk Arnsberg Christian Decker referierte über das für die Feuerwehr relevante Gefahrstoffrecht – einen nicht zu unterschätzenden Punkt, der unter anderem beinhaltet wie man in Industriebetrieben schnell an Informationen über die Reaktivität, Art und Menge der gelagerten Substanzen kommt. Um reaktive Substanzen ging es auch im Unterricht des Diplom-Chemikers und Chemielehrers Tobias Adam, der zusammen mit dem Wissenschaftler der Universität Siegen Stephan Vogt die Natur der Redoxreaktionen erklärte. So zeigten die beiden nicht nur wie das starke Oxidationsmittel Brom mit dem Reduktionsmittel Aluminium reagiert, sondern demonstrierten auch an einem Gummibärchen (welches als Gelatine der chemischen Struktur der menschlichen Haut stark ähnelt) die Wirkung von starken Oxidationsmitteln auf den Körper.

Foto: Sebastian Lünenstraß
Die letzte und siebte Station des Symposiums bildeten die Kameraden der Analytischen Task Force Dortmund (ATF) um den Dipl-Chem. Oliver Nestler und den Dipl.-Ing. Matthias Erve, die nicht nur ihr Equipment vorstellten sondern auch praktische Tipps zur Probennahme gaben.

Foto: Sebastian Lünenstraß
Etwa 120 Kameraden aus der gesamten Bundesrepublik und sogar auch ein Teilnehmer aus Polen nahmen am Symposium teil, das unter der Schirmherrschaft der Landräte aus den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein stand. Neben allen Unterrichtsmaterialien bekamen die Feuerwehrkameraden auch Zugang zu mehr als 35 selbst erstellten Gefahrstoffetiketten mit denen realistische Übungsszenarien ausgearbeitet werden können. Dazu gehört eine Liste mit typischerweise in verschiedenen Industrien anzutreffenden Reagenzien und einer Anleitung wie man aus Straßenmalkreide und Zucker täuschend echt aussehende „Gefahrstoffe“ nachbilden kann. Im nächsten Jahr wird Ende Oktober/Anfang November wieder ein Symposium „ABC-Gefahren“ stattfinden, da sind sich die Organisatoren und die Universität Siegen einig. Unterstützt wurden sie dabei maßgeblich durch den Kreisfeuerwehrverband Siegen-Wittgenstein.
Hier der passende Beitrag auf WDR.